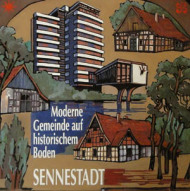Sennestadt
Über Peter Holst
Marc Wübbenhorst
Über Peter Holst
In Peter Holsts Haus sitzen wir gemeinsam am Tisch. Hier fallen mir zunächst die Zeichnungen auf, die an der Wand hängen. Detaillierte Architekturzeichnungen, die Herr Holst selbst angefertigt hat. Sie zeigen Gebäude, die kein Grafikprogramm spannender erzählen könnte. „Zeichnen ist mein Hobby“, sagt Herr Holst, „wenn man ein Gebäude gezeichnet hat, dann hat man es verstanden.“ In der heutigen Architektekturausbildung fehle das Freihandzeichnen, kritisiert er. Sein Vater war Professor an der Kunsthochschule, vielleicht war ihm das Künstlerische in die Wiege gelegt.
Nach dem zweiten Weltkrieg, er wurde nach dem zweiten Semester als Soldat eingezogen, studierte Peter Holst nach Jahren der Gefangenschaft in den USA und in England als junger Erwachsener Architektur. „Die Zeit nach dem Krieg war eine Zeit, in der die Karten neu gemischt wurden “ erinnert sich Peter Holst, der zunächst in Berlin bei seinem Professor arbeitete. „Ich hörte dann eher zufällig, dass Professor Reichow noch Architekten suchte.“ Eine neu entstehende Stadt, in deren Anfängen Peter Holst zunächst eine Wohnung in der Südstadt bezog. „Ich war der erste Bewohner der Südstadt, die Fenster waren noch gar nicht eingebaut“, erinnert er sich. Hier wohnte er acht Monate allein. Pioniere seien die Leute gewesen, die nach und nach ihre Wohnungen bezogen. Darunter auch Frau Waltraud Holst, geboren in Danzig, die damals noch in Berlin lebte. Mit ihrem ersten Sohn, der Älteste von insgesamt drei Kindern, war Sie in die neue Stadt nachgezogen. „Öfter mal bin ich mit dem Kinderwagen im Schlamm stecken geblieben“ ergänzt sie.
Die Erfahrung des Aufbaus hatte die Menschen zusammengebracht, jeder kam ja von irgendwo. So erzählt mir Herr Holst, wie er Schrippen kaufen wollte und schmunzelt: „Brötchen heißen hier ja gar nicht so.“ Familie Holst sah die Sennestadt zunächst als Zwischenstation, daraus sind dann 14 Jahre in der Südstadt geworden, 1970 das eigene Haus am Friesenweg, in dem er mit seiner Frau immer noch wohnt. Zu der Zeit des Hausbaus war Herr Holst bereits Baudezernent in Bielefeld, 1958 wurde er zunächst von der Stadt Bielefeld abgeworben, dann 1959 der Wechsel nach Brackwede und nach der Neuordnung eine Stelle im Planungsamt. Ab 1979 war er Leiter des Bauordnungsamtes.
Das kulturelle Leben begann damals in den Räumen der Adolf-Reichwein-Schule, die neuen Sennestädter wollten ihren Stadtteil mit Musik und Tanz füllen. Auch für ihn war dieses der Ausgangspunkt,
sich im Stadtteil zu engagieren.
Eines möchte ich noch nennen: Peter Holst hat sich für die Weiterentwicklung des Stadtteils verwendet, die Arbeit am Sennestadtmodell ist dafür fast symbolisch. Der Architekt setzt nicht nur neue
Gebäude in das Modell ein, sondern denkt die Reichow-Stadt inhaltlich und konstruktiv weiter. Deshalb ist er nicht zuletzt aufgrund seiner Ideen und modernen Ansichten in den Prozessen des
Stadtumbaus als Ratgeber gefragt.
Vita Peter Holst
| 1923 | Geburt in Berlin | ||
| 1942 | Abitur | ||
| 1942 | - | 1944 | Kriegsteilnehmer |
| 1944 | - | 1948 | Gefangenschaft in den USA und GB |
| 1948 | - | 1954 | Studium an der Hochschule für bildende Künste in Berlin |
| Abschluss Architekt HBK | |||
| 1954 | - | 1958 | Mitarbeit bei Professor Klaus |
| 1958 | - | 1962 | Büro Reichow, Sennestadt |
| 1967 | - | 1970 | Leiter der Planungsstelle Kreis Bielefeld |
| 1970 | Baudezernent in Brackwede | ||
| 1973 | Planungsamt der Stadt Bielefeld |
Folgende Gedanken zu verschiedenen Themen von Peter Holst stellen wir vor:
- Die Farbigkeit der Sennestadt und ihr Stellenwert im Stadtbild
- Kriterien der Standortbestimmung im Stadtorganismus
- Gedanken zur Adolf-Reichwein-Schule
Peter Holst
Die Farbigkeit der Sennestadt und ihr Stellenwert im Stadtbild
Die Sennestadtplanung als Stadtlandschaft ist in sich schlüssig, alle Einzelbereiche sind aufeinander und auf das Ganze bezogen. Als wichtiges Element der Stadtgestaltung gehört dazu die Farbigkeit der Wohnblocks und Hauszeilen. Farbe wird nicht als blasses Dekor gesehen, sondern ist notwendiger Bestandteil des organischen Städtebaus.
Prof. Reichow spricht im Zusammenhang mit Farben die „Heiterkeit der Straßen und Platzräume, der Wohnlichkeit über den Zeitgeschmack hinaus“ an und weist „auf vielgestaltige Bindungen, Steigerungen und Bekrönungen“ hin.
Der Stellenwert Farbkonzeptes ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte der Sennestadt. Zur Linderung der Wohnungsnot nach dem 2. Weltkrieg und als eine Heimat für viele Flüchtlinge und Vertriebene
aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten wurde Anfang der 50er Jahre die Sennestadt geplant und wenig später begonnen. Sie war konzipiert als selbständige Stadt mit umfassender Infrastruktur und
stellte ein Novum dar gegenüber den Stadterweiterungen, die von den Bauämtern der Städte organisiert und durchgeführt wurden, meist mit ausgesuchten Architekten.
Kennzeichen der Sennestadt ist dagegen, dass von Baubeginn an, aus vielen Orten der BRD kommend, eine Vielzahl von Baugesellschaften mit ihren Entwerfern und private Bauherren mit ihren Architekten ihre Bauten hier errichteten. Aufgabe der technischen und künstlerischen Oberbauleitung war es, alle diese unterschiedlichen Entwurfshandschriften zu koordinieren und Bauherren und Architekten zur Teamarbeit zu gewinnen. Das konnte nicht öffentlich-rechtlich geschehen, sondern wurde privatrechtlich mit den Grundstücksverträgen erreicht, Verträge, die noch heute ihre Gültigkeit haben. Die darin enthaltenen, zur Verwirklichung des städtebaulichen Konzeptes notwendigen Richtlinien, die für alle Beteiligten bindend waren, beschränken sich in den gestalterischen Vorgaben auf ein Mindestmaß. Die künstlerischen Vorstellungen und die finanziellen Möglichkeiten von Bauherren und Architekten sollten nicht mehr als unbedingt notwendig eingeschränkt werden, aber mit dem Ziel der Einordnung in das Konzept der Stadtlandschaft und die städtische Gemeinschaft.
Die aufeinander abgestimmten Farben der Gebäude unterstützen das planerische Leitbild durch Herausarbeitung städtebaulicher Zusammenhänge. Farbe fasst zusammen, ohne unterschiedliche Handschriften zu verwischen, setzt Akzente, schafft Spannungen, lässt Steigerung oder auch Abschwächungen zu.
Die eher bescheidene Architektur des sozialen Wohnungsbaus der 50/60er Jahre wird aufgewertet und trotz unterschiedlicher Handschriften der vielen in der Sennestadt tätigen Baugesellschaften und Architekten eine visuelle Geschlossenheit und Einheitlichkeit des Ortsbildes erreicht. Gesteigert wird die Leuchtkraft der Farben durch das Weiß der Fensterlaibungen und –faschen und der Loggien- und Balkonbrüstungen.
Die ursprüngliche Farbgestaltung ist nach Jahrzehnten nur noch in Teilbereichen erlebbar und oft mit den Jahren verblasst. Es zeigt sich aber deutlich, dass dort, wo diese Farbigkeit nicht mehr erkennbar ist, Gebäude und Wohnumfeld an Charakter und Wert verlieren. Verloren geht auch ein notwendiges verbindendes Gestaltungselement der Sennestadt.
Diese Erkenntnis hat eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung der Sennestadt Stichwort „Reichow für das 21. Jahrhundert“ und der Planung auf dem Schillinggelände gespielt. Aus dem Wissen um die ursprüngliche Farbpalette der Putzfassaden, noch vorhandenen Farben und alten Fotos ist jetzt ein Farbfächer mit aufeinander abgestimmten Farbwerten entwickelt worden, Grundlage für ein verbindliches Gesamtkonzept. Mit einer kontinuierlichen Umsetzung dieses Konzeptes über einen längeren Zeitraum kann die angestrebte Geschlossenheit und Heiterkeit des Stadtbildes für die Zukunft zurückgewonnen werden.
33689 Bielefeld, den 14.04.2014
Peter Holst, Architekt
Peter Holst
Kriterien der Standortbestimmung im Stadtorganismus
Der stadtbildprägende Einfluss der Landschaft auf den Stadtorganismus der Sennestadt ist sofort erkennbar: das Nord-Süd verlaufende Tal des Bullerbaches als grünes Rückgrat und dessen Kreuzung mit der Ost-West gerichteten alten Geländeabsenkung bilden vor dem ansteigenden Höhenzug des Osnings das „grüne Kreuz“.
Entlang dieser grünen Achsen liegen an naturgegebenen und herausgehobenen Stellen die Standorte für Gebäude mit besonderer Bedeutung für das Gemeinwesen. Diese Standortbestimmung ist genau überlegt und nicht zufällig und wesentliches Merkmal des Gesamtkonzeptes, um „der Rangfolge im öffentlichen Leben sinnvoll Ausdruck zu verleihen“ (Prof. Reichow), unabhängig von architektonischer Handschrift.
Da ist die „Stadtkrone“ (ein von Ernst May und anderen geprägter Begriff, den Reichow übernommen hat), um die Dominanz der Zentrumsbauten hervorzuheben. Hier ist das Gelände zur Halbinsel aufgeschüttet und der Wiesengrund geflutet. Die so entstandene Wasserfläche in einer nur von Bachläufen durchzogenen Landschaft erweckt Aufmerksamkeit, besonders wenn sich die Zentrumsbauten darin spiegeln.
Da sind die Kirchengebäude: sei es die alte auf einem Hügel gelegene kleine katholische Kirche, die ihre Dominanz durch Anordnung niedriger Bauten im Umfeld behält, oder die neue evangelische Jesus-Christus-Kirche, die auf einem Geländevorsprung im und oberhalb des Bullerbachtales auftrumpft.
Da sind die Schulen an den Grünachsen vom Schulzentrum im Süden bis zur Gebrüder-Grimm-Schule im Norden der Sennestadt. Besonders markante Standorte wegen ihrer Lage beidseitig der Bachaue am Übergang zum Ost-West-Grünzug besetzen die Astrid-Lindgren-Schule und die Adolf-Reichwein-Schule. Die Adolf-Reichwein-Schule wird zwar nicht mehr als Schule gebraucht, aber die Bedeutung und Qualität des Standortes hat sich nicht geändert. Der Anspruch bleibt, eine Lösung zu finden, sei es durch Umnutzung, Umbau oder teilweise Neubau, die der Bedeutung dieses Standortes gerecht wird durch ein Vorhaben von besonderer Bedeutung für das Gemeinwesen.
33689 Bielefeld, 30.07.2014
Peter Holst, Architekt
Peter Holst
Gedanken zur Adolf-Reichwein-Schule
Alle Besucher der Sennestadt sind überrascht von dem vielen Grün dieses Stadtbezirks. Die Akzeptanz der neuen Stadt ist aber vor allem abhängig von dem rechtzeitigen Entstehen und der Erreichbarkeit der Infrastruktur. Gerade die Sennestadt ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Grün und infrastrukturelle Einrichtungen sinnvoll zusammengeführt werden können. Schulen, Verwaltung, Kirchen bis hin zu den Versorgungsschwerpunkten liegen an prädestinierten Standorten der grünen Achsen, die das Stadtbild bestimmen und die Wohnbereiche gliedern. Für eine junge Stadt im Werden geht es wesentlich um das zeitgleiche Schulangebot. Für die Altgemeinde Senne II und die schon ursprünglich vorhandenen Bebauung wurde 1953 die Vennhofschule eingeweiht. Zeitnah zur Bebauung der neuen Sennestadt, die schwerpunktmäßig östlich des Bullerbaches begann, entstand 1959160 der erste Schulneubau – die Oststadtschule - am Rande des Bullerbachtales und dessen Schnittpunkt mit der grünen Querachse. Diese Schule ist neben dem Gymnasium der einzige Bau des Architekten Prof. Reichow in der Sennestädter Schullandschaft. Der Entwurf nimmt Gedanken auf, die Anfang der 50er Jahre in den „Fredeburger Richtlinien" entwickelt worden sind, aufgelockerte Bebauung, Pavillonklassen für die Jüngeren mit Freiräumen für den Außenunterricht, zweiseitige Klassenbelichtung, pädagogische Zentren etc. Die Dachformen der Schule korrespondieren mit der Silhouette des Teutoburger Waldes im Hintergrund.
Auf Vorschlag des ersten Rektors, Heinrich Kokemohr, erhielt die Oststadtschule den Namen Adolf-Reichwein-Schule, dem Reformpädagogen und Widerstandskämpfer mit Verbindung zum Kreisauer Kreis, der
1944 zu Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Der Name war Mahnung und zugleich Verpflichtung, das pädagogische Konzept weiter zu entwickeln. So wurde die Adolf-Reichwein-Schule lange Zeit
Vorreiter als erste Ganztagsschule.
Eine ganz besondere Erfolgsgeschichte nahm ebenfalls hier ihren Anfang. Rektor Heinrich Kokemohr war Gründungsmitglied des ,,Kulturrings Sennestadt" und übernahm dessen Vorsitz. Ein noch so gut
geplantes Gemeinwesen wächst erst durch gemeinsames Erleben in kultureller Vielfalt zu einer Gemeinschaft zusammen. In den ersten Jahren hatte es durchaus Ansätze gegeben durch Einladungen zu
Hauskonzerten oder Diskussionsrunden. Mit dem „Kulturring" kam der Durchbruch in die Breite, es begann eine Erfolgsgeschichte gesteigert noch durch die Aufbruchsstimmung in den Entstehungsjahren der
neuen Stadt. Standort der kulturellen Veranstalturlgen war in diesen Jahren das pädagogische Zentrum der Adolf-Reichwein-Schule das mit kleiner Bühne und Empore die Möglichkeit bot für Konzerte von
Klassik bis Jazz, für Lesungen, Kabarett und kleinen Theateraufführungen. Ältere Sennestädter erinnern sich noch gerne an die gemeinsamen Abende dort, an denen Kontakte geknüpft wurden und
Freundschaften entstanden.
33689 Bielefeld, 30.07.2014
Peter Holst, Architekt